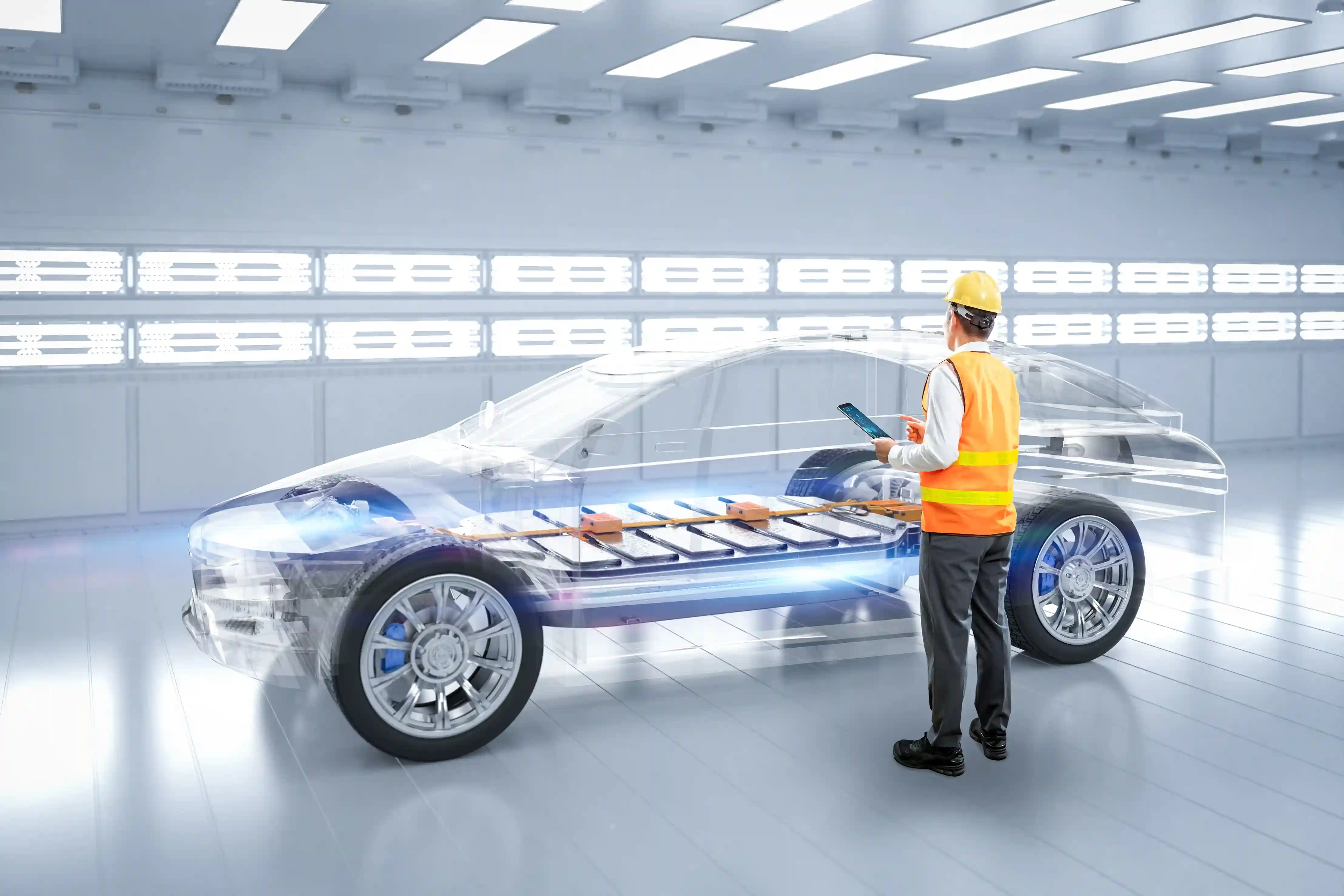
Rohstoffe, Second Life und Recycling – aus dem Leben einer E-Auto-Batterie
Rund 2,6 Millionen reine E-Fahrzeuge fahren derzeit auf Deutschlands Straßen, angetrieben von ebenso vielen Batterien. Noch viele weitere solcher Akkus kommen als stationäre Energiespeicher zum Einsatz. Der HOLM-Blog wirft einen Blick auf den Lebenszyklus dieser rohstoffintensiven Bauteile, die im Zentrum der E-Mobilität stehen.
Welche Arten von Elektrofahrzeugen gibt es?
Laut Kraftfahr-Bundesamt (KBA) [1] wurden in Deutschland 2024 insgesamt 2.817.331 Personenkraftwagen (Pkw) neu zugelassen. Die Behörde trennt in ihrer Statistik auch nach Kraftstoffarten. Danach betrug die Zahl der elektrisch angetriebenen Neuzulassungen 380.609 „reine“ Elektrofahrzeuge, so genannt BEV („Battery Electric Vehicle“, also batterieelektrische Fahrzeuge), und 947.398 Fahrzeuge mit Hybridantrieb. Es lassen sich verschiedene Arten von Hybridfahrzeugen [2] unterscheiden, die wichtigsten sind Vollhybride und Plug-in-Hybride. Beide besitzen größere Batterien für den Antrieb. Diese Akkus erlauben es, Strecken auch rein elektrisch zurückzulegen, ohne dass der Verbrennungsmotor (Diesel oder Benzin) zum Einsatz kommt. Das KBA zählte 2024 unter den Hybridfahrzeugen 191.905 Neuzulassungen mit Plug-in-Technologie. Damit lassen sich bei elektrischem Antrieb etwas höhere Reichweiten (bis zu 90 Kilometer) und höhere Höchstgeschwindigkeiten (bis zu 100 km/h) erzielen.
Wie viele E-Auto-Batterien gibt es in Deutschland?
Elektroautos, BEVs und Hybride besitzen im Regelfall zwei Batterien: Einen großen Antriebsakku, der für die Fortbewegung des Stromers verantwortlich ist, und eine 12-Volt-Batterie, wie man sie auch aus reinen Verbrennerfahrzeugen kennt. Rechnet man die rund 1,65 Millionen BEV und weitere rund 0,97 Millionen Plug-In-Hybride-Pkw hinzu, so gab es Anfang 2025 gut 2,6 Millionen zugelassene E-Autos in Deutschland [3] und die entsprechende Anzahl an Antriebsbatterien. Hinzu kommt eine unbekannte Anzahl von Fahrzeugbatterien, die außerhalb von Fahrzeugen als stationäre Energiespeicher in Gebrauch sind (siehe unten).

Bild: chuttersnap/unsplash.com
Woraus besteht eine E-Auto-Batterie?
Eine E-Auto-Batterie funktioniert im Prinzip wie eine 12-Volt-Autobatterie in zwei Richtungen: Sie kann elektrische Energie als chemische Energie speichern und auch wieder abgeben. Ein solcher Akkumulator besteht aus zwei Elektroden mit unterschiedlicher Ladung: einer Anode und einer Kathode. Heute werden in Elektrofahrzeugen zumeist Lithium-Ionen- oder Lithium-Polymer-Akkus verbaut [5; 6]. Die Kathode des Akkus besteht aus Lithium-Metalloxid, das neben Lithium verschiedene Anteile an Nickel, Mangan und Kobalt enthalten kann. Die Anode besteht aus Grafit, das mit einer hohen Energie- und Leistungsdichte sowie seiner langen Lebensdauer punktet.
Wie sieht die Autobatterie der Zukunft aus?
Aufgrund ihrer Bedeutung in Unternehmen und in der Wissenschaft wird intensiv an neuen Batterietechnologien geforscht. Die Ansätze reichen von Weiterentwicklungen der Lithium-Ionen-Akkus bis hin zum Einsatz von Keramiken in Feststoffbatterien. Welche Technologien in Zukunft das Rennen machen, ist jedoch noch offen. Die Ziele stehen jedoch fest: Kosten und Rohstoffabhängigkeiten senken, Reichweite und Lebensdauer erhöhen.

Woher stammen die Rohstoffe in einer E-Auto-Batterie und wo werden sie hergestellt?
Die wichtigsten Rohstoffe der am häufigsten verwendeten Lithium-Ionen-Akkus − also Lithium, Kobalt, Grafit und die verschiedenen Seltenen Erden – werden zum überwiegenden Teil fast ausschließlich außerhalb von Europa gefördert. Das bringt große Abhängigkeiten der hiesigen Industrie von diesen „kritischen“ Rohstoffen mit sich. In den Abbauländern ist die Förderung oft mit ökologischen und sozialen Problemen verbunden. [7]
Die größten Hersteller der E-Auto-Batterien befinden sich in China und Korea. [8] Zu Ihnen zählt auch der chinesische Mischkonzern BYD, der seit einigen Jahren als weltweit größter Hersteller von E-Autos gilt.
Bis 2030 hat sich die EU zum Ziel gesetzt, mindestens zehn Prozent ihres Bedarfs an strategisch wichtigen Rohstoffen aus eigener Gewinnung zu decken. Die Kapazitäten für die Verarbeitung sollen dann bei mindestens 40 Prozent liegen und mindestens 25 Prozent der Rohstoffe sollen aus Recycling innerhalb der EU gewonnen werden. Für die Batterieproduktion setzt die EU zudem auf eine engere Zusammenarbeit mit Norwegen, das über große Rohstoffvorkommen in der Nordsee verfügt. [9]
In Deutschland werden bis dato nur in einem Werk Batteriezellen für elektrische Pkw produziert: Das Werk des chinesischen Unternehmens CATL, weltgrößter Hersteller von E-Auto-Batterien, fertigt dort seit Ende 2022 für deutsche Automobilhersteller. Eine Reihe weiterer Batteriezellfabriken [10] anderer Unternehmen befinden sich im Bau oder sind geplant.
Was kostet eine E-Autobatterie?
Der Antriebsakku ist ein wesentlicher Kostenanteil bei einem E-Auto – aber er sinkt! 2020 lag der Durchschnittspreis eines E-Auto-Akkus bei rund 140 US-Dollar pro Kilowattstunde, 2024 nur noch bei 115 Dollar/kWh. [11] Zurzeit dürfte der Preis um die 100 Dollar/kWh liegen und 2026 könnte auch diese Marke gebrochen werden. Damit läge der Durchschnittspreis bei einem 50-kWh-Pack rein rechnerisch bei 5.000 Dollar. Aber von den deutschen Herstellern werden deutlich höhere Preise genannt [12], besonders im Falle eines Austauschs des Akkus.
Wie lange hält eine E-Auto-Batterie?
Die durchschnittliche Lebensdauer einer Batterie beträgt etwa acht bis zehn Jahre. [13] Entsprechend geben die meisten Autohersteller eine Akkugarantie von acht Jahren und 160.000 Kilometern an. In der Praxis hält ein Akku jedoch länger. Die Ladekapazität eines Akkus nimmt im Laufe der Jahre von Ladung zu Ladung ab. Fällt in der Garantiezeit die Restkapazität unter 70 Prozent, tauschen die Hersteller zumeist aus.
Was geschieht mit einer gebrauchten E-Auto-Batterie?
Wenn eine E-Auto-Batterie ausgetauscht werden muss, weil ihre Leistungsfähigkeit zu sehr abgenommen hat, kann sie für andere, weniger Leistung beanspruchende Einsätze verwendet werden. Sie erhalten dann beispielsweise als stationärer Stromspeicher für eine PV-Anlage in einem Privathaushalt ein zweites Leben, ein „Second Life“.
Aber auch für größere Energiespeicher, etwa fürs Handwerk oder das produzierende Gewerbe, werden gebrauchte Batterie wieder aufbereitet. Diverse Start-ups bieten dies mittlerweile an. Aber auch Autohersteller und die Deutsche Bahn sind in das Geschäft mit dem Kreislauf von Batterien eingestiegen. Beispiele dafür sind die DB-Tochter Encore oder Cylib. Cylip wird von Porsche und Bosch unterstützt und errichtet derzeit eine Recyclinganlage, die jährlich bis zu 30.000 Tonnen Altbatterien verarbeiten soll. [14] Während für private Anwendungen meist eine einzige ehemalige Antriebsbatterie ausreicht, werden für stationäre Speicher für Gewerbe und Industrie bis zu mehreren Hundert Akkus zusammengeschaltet und benötigt. Zum Teil werden dazu auch neuwertige Batterien verwendet, die aus Überproduktionen stammen.
Wie lassen sich die Rohstoffe aus einer E-Auto-Batterie zurückgewinnen?
Aufgrund von Messreihen von Alterungsprozessen im Labor rechnet der ADAC mit einem Second Life der Batterie von 10 bis 12 Jahren. Nach über 20 Jahren bei durchschnittlicher Beanspruchung endet das Leben eines E-Auto-Akkus und er wird ein Fall für die Entsorgung.
Das Batterie-Recycling beginnt mit der manuellen Demontage eines Batteriesystems, danach folgen das Sortieren, Schreddern und die thermische Aufschmelzung. Am Ende des Prozesses steht die Materialtrennung: Aluminium, Stahl und Kunststoffe aus dem Gehäuse sowie wertvolle Metalle und Grafit aus dem Inneren. [15]
Das Recycling ist zum Teil sehr energieaufwendig, lohnt aber aufgrund der großen Menge wertvoller Rohstoffe. Zudem ist das Recycling in der EU Pflicht. Laut der EU-Batterie-Verordnung von 2023 beträgt die vorgeschriebene Wiederverwertungsquote für Batterien 90 Prozent. Zudem müssen neu produzierte Batterien einen Mindestanteil von recyceltem Material (Recyclat) enthalten, dessen Quoten steigen. So soll ab 2031 etwa der Recyclat-Anteil von Kobalt 16 Prozent und ab 2036 gar 26 Prozent betragen.
In einem rund 400 Kilogramm schweren Lithium-Ionen-Akku mit 50 kWh Kapazität stecken laut Volkswagen aktuell etwa ...
... aus dem Inneren:
- 8 kg Lithium
- 9 kg Kobalt
- 12 kg Mangan
- 41 kg Nickel
- 71 kg Grafit
... aus dem Gehäuse:
- 22 kg Kupfer
- 126 kg Aluminium
- 3 kg Stahl
Dazu können 37 Kilogramm Elektrolyt und 21 Kilogramm Kunststoffe recycelt werden.
Quellen
[1] Kraftfahr-Bundesamt (KBA) (2025): Neuzulassungen nach Umwelt-Merkmalen, Jahr 2024. Zuletzt geprüft: 21.08.2025
[2] Vgl. Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft (DA): Welche Arten von Hybrid-Autos gibt es? Zuletzt geprüft: 21.08.2025
[3] Kraftfahr-Bundesamt (KBA) (2025): Bestand an Kraftfahrzeugen nach Umwelt-Merkmalen, 1 Januar 2025. Zuletzt geprüft: 21.08.2025
[4] Shell.de: Ladezeit E-Auto: Ladedauer, Akkus Akkupflege und Lademöglichkeiten von Elektroautos erklärt. Zuletzt geprüft: 21.08.2025
[5] Vgl. auto motor und sport: Die Herzen der Elektroautos. Zuletzt geprüft: 21.08.2025
[6] Vgl. Volkswagen Financial Services: Elektroauto-Batterie. Zuletzt geprüft: 21.08.2025
[7] Siehe zum Thema Rohstoffabhängigkeit etwa die Kurzstudie des Umweltbundesamts (2023): Rohstoffe der Elektromobilität.
[8] Vgl. Produktion.de (2024): Die 10 größten Batteriehersteller für E-Mobility. Zuletzt geprüft: 21.08.2025
[9] Zeit online (2024): Batterienproduktion in der EU laut Studie emissionsärmer als Importe. Zuletzt geprüft: 21.08.2025
[10] Vgl. Wikipedia: Liste von Batteriezellfabriken in Deutschland. Zuletzt geprüft: 21.08.2025
[11] electrive (2024): E-Auto-Akkus kosten im Schnitt 115 Dollar/kWh. Zuletzt geprüft: 21.08.2025
[12] Auto Bild (2024): So teuer sind Tauschakkus fürs Elektroauto. Zuletzt geprüft: 21.08.2025
[13] Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft (DA): Elektroauto-Akku defekt – so handeln Sie richtig. Zuletzt geprüft: 21.08.2025
[14] Business Insider (2025): Abhängigkeit von China und USA reduzieren: Diese drei deutschen Startups recyclen Akkus von E-Autos. Zuletzt geprüft: 21.08.2025
[15] ADAC (2023): Elektroauto-Akkus: So funktioniert das Recycling. Zuletzt geprüft: 21.08.2025







